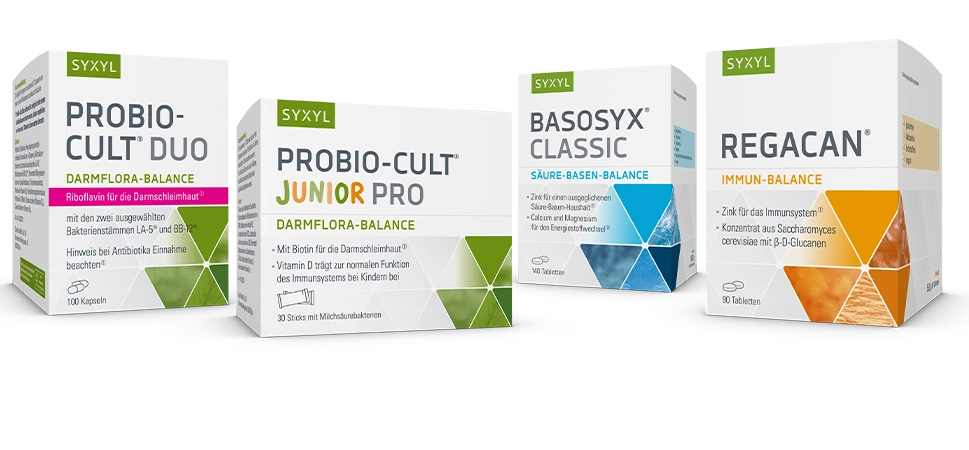Pflichttexte
Drüfusan Tabletten Anwendungsgebiete: Drüfusan Tabletten sind ein registriertes homöopathisches Arzneimittel ohne Angabe einer Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ginkgo Syxyl Tabletten Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, sollte medizinischer Rat eingeholt werden. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Harnsäuretropfen F Syxyl Anwendungsgebiete: Harnsäuretropfen F Syxyl sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. Harnsäuretropfen F Syxyl werden entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Behandlung von Gicht und Rheuma. Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Warnhinweise: Enthält 51 Vol.-% Alkohol. Bitte Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Milzimmunosyx Anwendungsgebiete: Milzimmunosyx ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion. Milzimmunosyx wird entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion. Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen. Warnhinweise: Enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bitte Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.